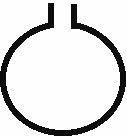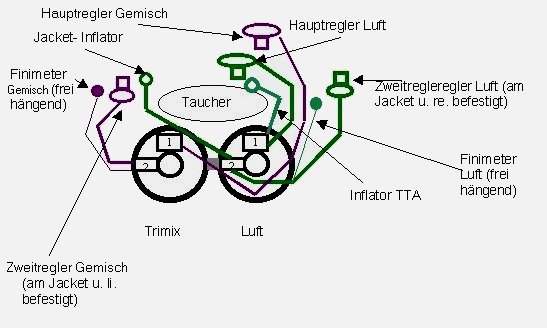Homepage
von Peter Rachow Startseite - Home
Ein 10-l Doppelflaschengerät
für das Tauchen mit O2-He-N2-Gemisch und/oder Luft
von Peter Rachow
Vorwort
Grundgedanken
Hardware
Atemregleranordnung/Schlauchführung
Tauchpraxis
Abschluss
und Anmerkungen
Erfahrungen

Vorwort
Dieses Bauprojekt
ist gedacht für den erfahrenen und technisch interessierten
Sporttaucher.
Es ist
nicht
gedacht für Anhänger einer der neumodischen
"
Tech
tauchphilosophien" (wie. z. B. "DIR", TecRec von PADI, etc.),
denn der hier gezeigte Bauvorschlag hat nichts mit dem Quatsch
amerikanischen
Ursprungs zu tun, der sich seit einigen Jahren etabliert hat und der
auf
den Namen
Techdiving
hört. Diesen Hinweis möchte ich insbesondere
deshalb geben, weil bei diesem Projekt gemischte Atemgase (O
2
-He-N
2
-Mischgas)
verwendet werden, die jene Leute, die sich selbst gerne als "Techies"
bezeichnen,
ebenfalls benutzen. Purer Zufall, mehr nicht. ;-))
Lesen
Sie hier Reaktionen von sig. "
Techdivern
" auf diesen Artikel
1.
Grundgedanken
Zielsetzung war es,
ein einfaches Doppelflaschengerät bauen, das benutzt werden kann,
um Tiefen bis ca. 75 Meter bei moderaten Grundzeiten (max. 5 bis 10
min.)
aufzusuchen. Die beiden Flaschen sind unabhängig, sie können
also beide mit Pressluft gefüllt werden bzw. anstatt mit
entspannten
4000 m³ Luft zu tauchen, ist eine weitere Möglichkeit,
für
die tiefe Phase des Tauchganges ein Atemgas zu verwenden, dessen
narkotisches
Potenzial aufgrund eines verminderten Stickstoffpartialdruckes geringer
ist als jenes von Luft. Das Atemgas für diese Phase ist folglich
ein
O
2
-He-N
2
-Gemisch.
Je nach max. geplanter Tiefe des Tauchganges verwende ich z. B. max.
50%
He-Anteil, was bei einer Wassertiefe von 75 Metern einen
Stickstoffpartialdruck
von 0,5 * 0,78 * 8,5 bar = 3,3 bar ergibt. Dies entspricht einer
Wassertiefe
von ca. 30 Metern unter Luftatmung.
Die Rahmenbedingungen
für das Projekt waren also:
-
Es wird ohne Zusatzflaschen
(im "Tech"-Kauderwelschjargon als „Stages“ bezeichnet)
getaucht.
-
Der Atemgasvorrat
beträgt entspannt insgesamt ca. 4000 Liter, entweder nur Luft oder
O
2
-He-N
2
-Mischgas und Luft.
-
Der Gasvorrat verteilt
sich hälftig auf beide Flaschen: O
2
-He-N
2
-Gemisch
in einer Flasche, Luft in der anderen.
-
Je 2 getrennte Regler
für die einzelnen Flaschen + 2 Finimeter.
-
Vom Gewicht her noch
praktikabel zu handhaben.
-
Preisgünstiger
Aufbau der Doppelgeräthalterung mit Baumarktteilen.
-
Einfach und universell
am Jacket zu montieren.
-
Halterung schnell
wieder zu trennen und zusammenzusetzen, da die Flaschen auch einzeln
verwendet
werden sollen.

Das fertige
Doppelflaschengerät
2.
Die Hardware
2.1 Material
Für die Halterung
der Flaschen wurden, wie beim
Doppel-4-Litergerät
,
wieder Alu-Profile aus dem Baumarkt verwendet. Man benötigt an
Material:
-
Je 2 Stck. Vierkantrohr
(2 cm Kantenlänge), Länge je nach Flaschenlänge, ca. 45
cm.
-
4 Bänder (2 cm
breit, 1,5 bis 2 mm stark, Länge siehe Beschreibung).
-
Schrauben M6 in verschiedenen
Längen.
-
Muttern M6 in größerer
Zahl, 2 Stck. M10 als Distanzhalter.
-
Unterlegescheiben
Durchmesser ca. 2 cm für Schrauben M6 in größerer Zahl.
-
Mehrere Stücke
eines alten, aufgeschnittenen Fahrradschlauches, Länge
entsprechend
Flaschenumfang + ca. 2 cm
Noch ein Hinweis zu
den Schrauben, Muttern und Scheiben bzw. deren Materialqualität:
Da
ich dieses Tauchgerät nur im Süsswasser verwende, benutze ich
die normale Qualität der in den großen Baumärkten
angebotenen
Schrauben oder max. Stahl der Spezifikation V2A aus dem
Schraubenfachhandel.
2.2 Vorbereitung
2.2.1 Die Befestigungsschellen
für die Flaschen
Als erstes werden
aus den Alu-Bändern die Schellen für die Flaschen
hergestellt.
Diese haben folgende Form:
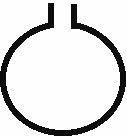
Zur Herstellung
geht man folgendermaßen vor: Zuerst wird aus dem Alu-Band ein
Stück
entsprechend dem Flaschenumfang + ca. 4 cm herausgeschnitten (mit einer
Metallsäge!). 3 cm von einem Ende wird das Band abgebogen, so dass
es in einem Winkel von ca. 45° bis 50° zum restlichen Band
steht.
Am besten spannt man dazu das kurze Ende in eine einfache, selbst
gebaute
Biegevorrichtung zwischen zwei stabile Holzstücke in einen
Schraubstock
ein, damit man genau abbiegen kann. In dieses kurze gerade Ende wird
nun
zentral ein Loch mit 6,5 mm Durchmesser gebohrt durch das später
die
die Schelle fixierende Schraube geführt wird.
Das restliche Band
wird nun um die Flasche gebogen, so dass sich die beiden Enden
berühren.
Nun sollte das Band mehrmals an der Flasche angedrückt werden, um
die Spannung des Bandes abzubauen und es auf eine kreisförmige
Geometrie
zu bringen.
Jetzt kommt der
schwierigste Teil: Auch auf der noch geraden Seite wird das Band
ebenfalls
abgebogen. Dabei muss die Länge des Zwischenraumes zwischen den
Bandenden
stimmen, damit das Band nachher in etwa genau die Flasche umfasst, (i.
e. etwas kürzer als der verbleibende Umfang ist) und auf Spannung
verschraubt werden kann.
Dazu habe ich mir
einen kleinen Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 2,5 mm aus
einem Abfallstück herausgesägt. Dieser kleine Klotz wird nun
an das bereits abgebogene Ende geschraubt und das noch nicht gebogene
Ende
dagegen gebogen. Der Klotz liegt also zwischen den Enden des Bandes.
Damit
hat man relativ genau die passende Distanz für das später
einzubauende
2 cm-Alurohr. Wie das erste Ende wird auch hier ein passendes Loch
gebohrt
und der Rest des Bandes nach Bedarf abgeschnitten und glatt gefeilt, so
dass sich eine exakt passende Schelle ergibt.
2.2.2 Die Verbindungselemente
Nach dem Herstellen
der 4 Schellen sägt man 2 Stück Alu-Vierkantrohre aus den
gekauften
Profilen ab. Die Länge muss entsprechend der verwendeten Flasche
gewählt
werden. Ich habe die Schellen so positioniert, dass die obere einige cm
unter der Flaschenschulter ansetzt und die untere direkt über den
Standfüßen anliegt. In die Alu-Vierkantrohre werden nun die
Löcher für die 4 Schellen gebohrt, sowie 2 im 90°-Winkel
dazu versetzte, die für die Verbindungsschrauben der
Alu-Vierkantrohre
gedacht sind.
Anschließend
werden die Schellen an die Flaschen geschraubt und zwar unter
Zwischenlage
eines Gummistreifens, der aus einem alten Fahrradschlauch
herausgeschnitten
wurde.
Das Ganze sieht
dann in etwa so aus, hier allerdings mit Schrauben M8:

Hinter den beiden
parallel verlaufenden Alu-Vierkantrohren findet sich im Bild oben eine
weitere Längsstrebe. Diese ist ein Zwischenstück, da bei
meiner
Konstruktion die Schrauben, mit denen das Gerät am Jacket
verschraubt
werden sollte, zu kurz waren.

Noch eine Detailansicht
der unteren Verschraubung. Die Schellen sind mit Schrauben M6 x 40 bzw.
M8 x 40 mit den Alu-Vierkantprofilen unter Zwischenlage großer
Unterlegescheiben
verschraubt, die beiden Trägerprofile werden durch eine
Schlossschraube
M6 auf den richtigen Abstand gebracht, um die Jackettrageschrauben
durchzuführen.
Zwischen den beiden Vierkantträgern liegt eine Mutter M10 als
Abstandshalter
(etwas undeutlich erkannbar wegen des Blitzlichtes).
2.2.3 Der Tragegriff
Man sägt nun
ein weiteres Stück Alu-Vierkantrohr ab, das genau zwischen die
beiden
Ventilflansche der Flaschen passt (siehe unteres Bild).
Anschließend
werden aus Alu-Flachprofil 2 Schellen gebogen, die den Griff an den
Flaschenhälsen
anschrauben indem sie diese umfassen. Den Griff selbst sollt man mit
einer
grifffreundlichen Umfassung versehen, z. B. einem Stück
Gartenschlauch
oder Neopren, damit das Gerät länger schmerzfrei getragen
werden
kann ;-)).

Tragegriff:
Aluprofil (Quadratischer Querschnitt, 2 cm Kantenlänge) umwickelt
erst mit Neopren, dann mit Kunststoffseil, li. und re. gesichert durch
Gummistreifen aus Fahrradschlauch.
Detailansichten:
2.2.4 Endmontage
Nun wird das ganze
fertige Gerät noch an das Jacket geschraubt. Dazu kann man
zwischen
den beiden Alu-Vierkantrohren 2 oder 3 Schrauben, je nach
Jackethalterung
durchführen (bzw. wie oben gezeigt, durch Einbau einer
Zwischenstrebe)
und diese an den vorgesehenen Punkten des Jackets einschrauben.
Hinweis:
Ein derat schweres Gerät muss sehr sicher verschraubt werden! Die
Schrauben sind ggf. nach einigen Stunden nochmals nachzuziehen
3.
Anordnung der Atemregler
Folgende Anordnung
für Regler und Finimeter an den Flaschen habe ich verwendet, wenn
ich Mischgas und Luft benutze:
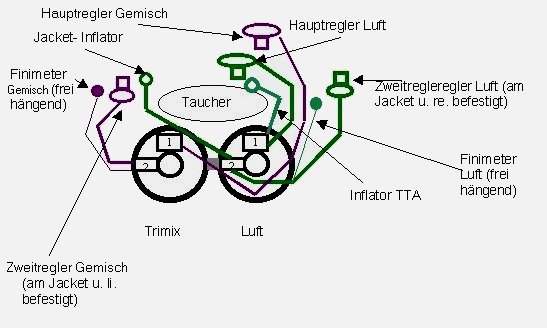
Zusätzliche
Hinweise:
-
Pro Flasche werden
2 unabhängige Regler verwendet.
-
Die Hauptregler kommen
gemeinsam von rechts.
-
Die Schläuche
der Hauptregler werden parallel geführt. und mit Kabelbindern so
zusammengebunden,
dass man beim Gaswechsel die Regler gut erreichen kann. Der nicht
benutzte
Regler hängt stets in Reichweite.
-
Die Zweitregler werden
an Haltern am unteren Ende des Jackets befestigt.
Wird nur mit Luft
getaucht, benutze ich pro Flasche je einen Atemregler mit je einem
Finimeter.
Die Regler werden gewechselt, nachdem die jeweilige Flasche den halben
Druck erreicht hat, also bei 100 bar, 50 bar, 25 bar.
4.
Praxis
4.1. Gas mischen
Um sich selbst die
benötigte O
2
-He-N
2
-Mischung herzustellen, besorgt
man sich im technischen Gashandel Helium der Qualität
4.6
in
einer Vorratsflasche. Gefüllt wird mit einem Adapter von Edelgas
auf
Luft und einem Umfüllschlauch mit Manometer nach der
Partialdruckmethode.
Befüllt wird die fast leere Empfängerflasche (ca. 1 bis 2 bar
Restdruck) zuerst mit Helium. Die restliche Gasmenge ist dann
Pressluft.
4.1.1 Quantitäten
Das Berechnen des
He-Anteiles geschieht nach dem Verfahren der "Äquivalenten
Narkosetiefe"
(AENT). Sie gibt an, welcher sticktoff-bezogenen Narkosetiefe eine
bestimmte
Wassertiefe entspricht. Diese AENT legt man also für die maximal
zu
erreichende Tauchtiefe fest und für einen Stickstoffpartialdruck
(ppN
2
),
den man dort noch tolerieren zu können glaubt.
Ein Rechenbeispiel:
Legt man einen
ppN
2
so fest, dass man sich wie in einer Tiefe von 70 Metern
so fühlen will, wie bei 40 m Wassertiefe unter Luftatmung, wird
folgendermaßen
gerechnet (dargestellt wird der ausführliche Weg):
40 m Wassertiefe
(s) entspricht einem Umgebungsdruck (p.amb) von ca. 5 bar.
p.amb
=
Rho
H2O
* G * s + p
Luft
= 1,005 kg/dm³
* 9,81 m/s² * 40 m + p
Luft
= 394 (kg*m²)/(s²*dm³)
+p
Luft
= 394 (N*m)/dm³
+ p
Luft
~ 39,4 (kg*m)/dm³
+p
Luft
= 394 (kg*dm)/dm³
+p
Luft
= 394 (kg/dm²)
= 3,94 kg/m²+p
Luft
= 3,94 bar + 1
bar = 4,94 bar ~
5 bar
.
Wenn gilt: Partialdruck
= Umgebungsdruck * Gasanteil, so schreiben wir für den max.
zulässigen
Partialdruck:
pp.max = p.amb
* f
(Gleichung I)
Der Stickstoffpartialdruck
bei Luft (f.N
2
= 0.78) in dieser Wassertiefe ist
ppN
2
=
5 bar * f.N
2
= 5 bar * 0.78 =
3,9 bar
(Gleichung II)
Der maximale ppN
2
in
der Tiefe von 70 m darf also ca.
3,9 bar
betragen.
Lösen wir
die Gleichung II nach f auf und verwenden den max. zulässigen ppN
2
,
so erhalten wir:
f = pp.max / p.amb
(Gleichung
III)
Setzen wir unsere
vorher gefundenen Werte ein, ergibt sich bei 70 m WT und einem dortigen
Umgebungsdruck von p.amb = 8 bar für den Stickstoffanteil in der
Gasmischung:
f
= 3,9
bar / 8 bar = 0.48 (entspr.
48% f.N
2
)
Um auf 48% N
2
-Anteil
zu kommen, benötigt man eine bestimmte Menge an Luft. Diese
errechnet
sich zu
f.Luft
=
f.N
2
/ 0.78 =
0,61
(=
61% Luftanteil in der Gasmischung
)
Der Rest ist Helium,
nach der Formel
f.He
= 1
- 0,61 =
0,39
(=
39% He-Anteil in der Flasche
)
Eine leere 200-bar-Flasche
(1 bar Restdruck) wäre also näherungsweise zuerst bis zu 200
bar * 0,39 =
78 bar He
zu befüllen. Dann wird aus dem Kompressor
an der Füllstation mit Luft bis zum maximalen Flaschendruck von
ca.
200 bar mit Luft aufgefüllt.
4.1.2 Weitere Rechnungen
Das Gemisch enthält
jetzt zwangsläufig einen niedrigeren Sauerstoffanteil als Luft, es
wird
hypoxisch
. Dieser Anteil berechnet sich zu
f.O
2
=
f.Luft * 0,21
(Gleichung IV)
In unserem Beispiel
ergibt sich für den Anteil an O
2
:
f.O
2
=
0,61 * 0,21 = 0,1281 (entspricht ca. 13% Sauerstoffanteil)
Um auf einen Sauerstoffpartialdruck
(ppO
2
) äquivalent zur Oberfläche (p.amb = 1 bar) zu
kommen, müsste man theoretisch einen Umgebungsdruck von
f
=
pp / p.amb => p.amb = pp / f =
1,61 bar
erreichen. Dieser
Wert wird nach Subtraktion von 1 bar Oberflächenluftdruck in einer
Tiefe von ca. 6 Metern erzielt. In der Praxis lassen sich solche
hypoxischen
Gemische aber auch oberhalb dieser Wassertiefe atmen, wenn man auch
keine
Höchstleistungen mehr vollbringen können wird. Unter 0,16 bar
ppO
2
sollte man den Sauerstoffpartialdruck allerdings nicht
fallen lassen. Dies entspricht dann einem Aufenthalt in ca. 2000 Meter
über NN.
Die Einsatztiefen
des jeweiligen Gemisches lassen sich auch mit einer
Excel-Tabelle
ermitteln.
4.2 Tauchen
Der Tauchgang lässt
sich nicht mehr ganz so einfach gestalten, wie ein Nullzeit-TG mit
einer
12-Liter-Flasche auf den Malediven ;-)). Im Prinzip wird er geplant wie
ein TG mit Luft in den selben Tiefenbereich. Gute Hilfe leisten die in
unserem
Tieftauch-Reader
beschriebenen
Verfahren (Drittel-Regel, Luftverbrauchrechnungen,
Dekompressionsvorgehen).
Auch die Hinzuziehung einer TG-Planungssoftware, wie
Visual
Decompression
, schadet sicher nicht.
In der Praxis ist
der Aufenthalt in der Tiefe allerdings durch die Mischgasmenge
bestimmt.
Die Luft in der zweiten Flasche reicht regelmäßig deutlich
länger
als das Gemisch für die Grundphase in der ersten. Der Tauchgang
wird
stets die Gestalt haben, dass die größte Tiefe zuerst
aufgesucht
wird und dann eine exponenzielle Austauchphase sich anschließt.
4.2.1 Abtauchen
Das Abtauchen geschieht
mit Luft. In einer Tiefe von ca. 35 bis 40 Metern wird auf Mischgas
gewechselt.
Um beide Hauptatemregler stets ohne Probleme erreichen zu können,
habe ich sie mit Kabelbindern ca. 30 cm von den zweiten Stufen an den
Mitteldruckschläuchen
zusammengebunden. Wenn man den einen Regler im Mund hat, hängt der
andere sehr nahe beim anderen.
Wichtig ist es,
die Regler sehr gut unterscheiden zu können. Ich tue dies, indem
ich
Luft aus einem Scubapro D400 atme, und das O
2
-He-N
2
-Gemisch
aus einem G250. Beide Regler haben eine stark unterschiedliche Form,
die
man alleine durch die Berührung erkennen kann. Wo das nicht der
Fall
ist, müssen beide Regler deutlich markiert werden, etwa, indem man
mit einem Kabelbinder eine Markierung am O
2
-He-N
2
-Regler
befestigt.
4.2.2 Grundphase
Die Grundzeit wird
nach dem durchschnittlichen Verbrauch an Atemgas festgelegt, den man
kennen
sollte. Weiterhin wird ein Sicherheitszuschlag eingerechnet. In der
Praxis
leite ich den Aufstieg spätestens dann ein, wenn sich in der O
2
-He-N
2
-Flasche
nur noch 100 bar Druck befindet, so lassen sich Grundzeiten von 5 bis
max.
10 Minuten auf Tiefen zwischen 60 und 70 Metern erreichen. Die
Gaswechseltiefen
müssen dann entsprechend angepasst werden, um beide Komponenten
(Mischgas
& Luft) möglichst effektiv zu nutzen
4.2.3 Austauchen und
Dekompression
Beim Austauchen wird
in einer Tiefe von ebenfalls ca. 30 Metern wieder auf Luft gewechselt.
Dort wird dann auch ein tiefer Stopp von ca. 2 bis 3 Minuten eingelegt,
um das schnell diffundierende Helium insbesondere aus den schnellen
Kompartimenten
initial zu eliminieren. Diesen Stopp mache ich bei einem He-Anteil von
z. B. 40% mit einem Zeitansatz von 3 Minuten. Bei geringerem He-Anteil
evtl. etwas verkürzt.
Danach wird relativ
langsam (v
max.
= 4 bis 5m / min.) auf die erste Dekostufe aufgestiegen.
Meistens dekomprimiere ich nach Luftregeln mit einer sehr stark
exponenziell
verlaufenden und um den Faktor 1,5 verlängernten Austauchphase.
Durch
den Wechsel auf Luft erhält man bei der Gaswechseltiefe für
He
einen sehr steilen Inertgasgradienten (p.i.atemgas / p.i.gewebe), was
eine
schnelle Elimination des He ermöglicht. Da die Dekompression nach
Luftregeln aber verlängert abläuft, befindet man sich also
relativ
weit auf der sicheren Seite, in der Praxis würden sich theoretisch
verkürzte Dekompressionzeiten ergeben. Beim Tauchen habe ich aber
nach konservativem Luftverfahren und einer minimierten
Aufstiegstgeschwindigkeit
getaucht.
Falls mit Softwareprodukten
gerechnet wird, kann die Dekompression natürlich auch nach deren
Vorgaben
durchgeführt werden.
4.3. Notfallprozeduren
Da mit zwei vollständig
redundanten unabhängigen Systemen getaucht wird, ist die
Wahrscheinlichkeit
einer fatalen Fehlfunktion gering. Vorteil der Verwendung von Luft
gegenüber
Nitrox als Gas ist hier insbesondere, dass nun beide Gase eine relativ
große Einsatzbandbreite haben, was den Tiefenbereich betrifft, in
dem die Gase jeweils zu verwenden sind.
Folgende Handlungsstrategien
sind im Fehlerfalle anwendbar. Das Versagen einer Gaszufuhr ist hier
definiert
als Ausfall von Haupt-
und
Zweitregler.
4.3.1 Luftzufuhr versagt
während der Abtauchphase
Auf O
2
-He-N
2
-Gemisch
als Atemgas wechseln, Tauchgang geordnet abbrechen, also langsam
aufsteigen
bis in den 10m-Bereich, dort einen Stopp für einige Minuten
durchführen,
dann langsam austauchen. Minimaltiefe beachten, damit der ppO
2
nicht zu gering wird.
4.3.2 O
2
-He-N
2
-Gemischzufuhr
versagt während der Abtauchphase
Auf Luft wechseln
und TG in geringen Tiefen fortsetzen. Dann TG geordnet beenden.
4.3.3 O
2
-He-N
2
-Gemischzufuhr
versagt während der Grundphase
Auf ca. 45 Meter WT
aufsteigen und auf Luft wechseln. Dekompression nach Luftregeln
durchführen.
4.3.4 O
2
-He-N
2
-Gemischzufuhr
versagt während der Austauchphase im tiefen Bereich (60 bis ca. 40
m)
Auf ca. 45 Meter aufsteigen
und auf Luft wechseln. Dekompression nach Luftregeln durchführen.
4.3.5 Luftzufuhr versagt
während der Auftauchphase
O
2
-He-N
2
-Gemisch
weiter verwenden, dann bei Tauchpartner Luft atmen. Dekompressionphase
evtl. abkürzen, tiefen Teil der Dekompression aber unbedingt
durchführen.
5.
Abschluss und Anmerkungen
Dass das Tauchen mit
diesem Tauchgerät und in die gezeigten Tiefen von ca. max. 75
Metern
WT (besonders im Süßwasser) nur erfahrenen und sicheren
Tauchern
vorbehalten ist, dürfte selbstredend sein. Beherrschung der
Ausrüstung,
Tarierfähigkeiten, Tieftaucherfahrung mit Luft, Erfahrung mit
kritischen
Situationen etc. sollten kein Thema mehr sein. Auch die sehr gute
Kenntnis
der Dekompressionstheorie(n) ist ein absolutes Muss. Tauchpraxis: Eine
TG-Anzahl von einigen hundert tieferen TG ist m. E. für das
Tieftauchen
(ob mit oder ohne Mischgas) elementare Voraussetzung.
6.
Erfahrungen
Trotz der zahlreichen
Unkenrufe gewisser selbsternannter
"Tekk"-Diver
und "Profimechaniker" erweist sich das gezeigte
Doppelflaschentauchgerät
im praktischen Einsatz als äußerst robust und mechanisch
sehr
stabil. Ich habe damit mittlerweile viele Tauchgänge z. B. im
Bodensee,
Walchensee und nahen tiefen Baggerseen sowie im
MIttelmeer
durchgeführt. Der mechanische Aufbau überstand das alles
(inklusive
dem dauernden Verfrachten aus und in das Auto hinein bzw. den Transport
als Fluggepäck) ohne Beschädigungen, Verwindungen,
Lockerwerden
von Schrauben oder Verbindungen bzw. Materialbruch. Für mich
bewahrheitet
sich hier wieder der Leitsatz "Probieren geht über studieren" bzw.
die Erkenntnis, dass es bei den Hobbyaquanauten sehr viele Menschen
gibt,
die man salopp schlicht als "Dummschwätzer" bezeichnen
könnte.
Das Gerät
lässt sich zudem sehr schnell wieder trennen und in die
Einzelflaschen
aufteilen. Der Zusammenbau dauert mittlerweile nur noch 5 Minuten.
Fazit: Eine sehr
preisgünstige Alternative zu den im Handel angebotenen, m. E. oft
vollkommen überteuerten, kommerziellen Verbindungslösungen
für
Doppelflaschen. Zahlt man dort ca. 70 bis 90 Euro pro Schellensatz so
gibt
es das komplette Material für dieses Gerät schon für ca.
15 Euro.
Peter Rachow